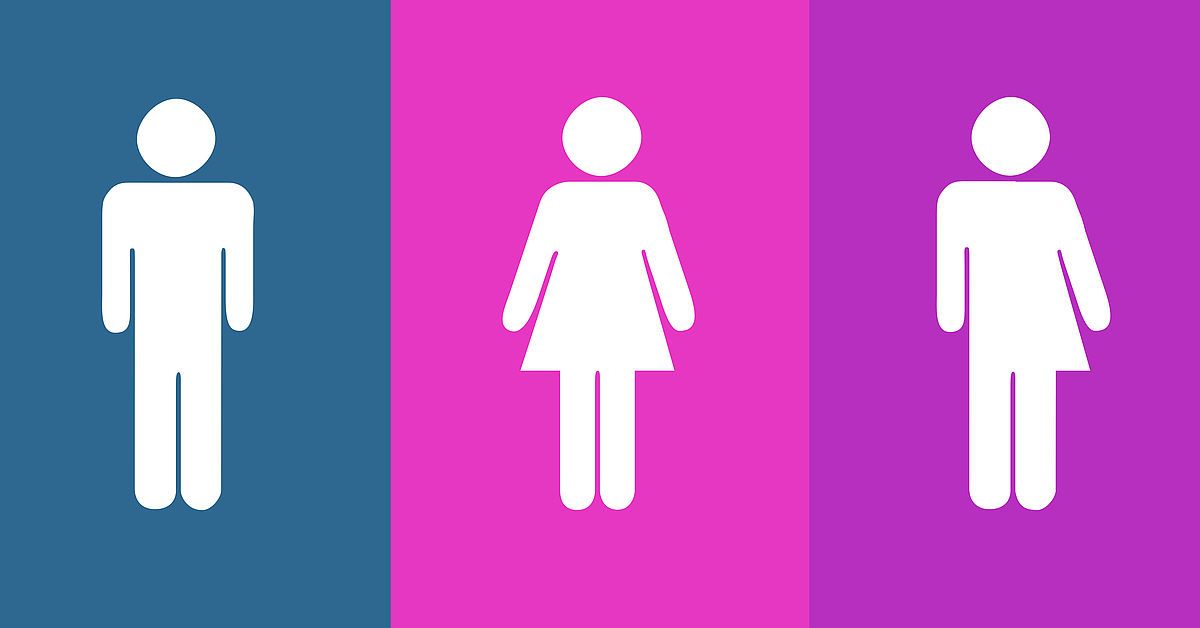
Reden Journalisten, die in öffentlichrechtlichen Medien zur Erziehung des Publikums gendern, auch privat so? Zweifel sind angebracht. Abgesehen davon, dass die ubiquitäre Sexualisierung der Sprache die Gesellschaft trennt, führt sie zu keinerlei Fortschritt.
NZZ, 17.2.2022, Gerfried Ambrosch

In den Sternen steht, was der Genderstern genau bringen soll.
Auch wenn es heute vielerorts zum guten Ton gehört, bleibt die Sinnhaftigkeit des Genderns fragwürdig. Kritik daran wird jedoch häufig als wütender Ausdruck männlichen Privilegienverlusts abqualifiziert. Eine solche Motivunterstellung dient dann als Ersatz für stichhaltige Argumentation.
Der Forderung nach gegenderter Sprache liegt meist eine Verwechslung zwischen grammatikalischem und biologischem Geschlecht zugrunde. Der Schreibtisch ist männlich, allerdings nur seiner Grammatik nach. Bei Personen verkompliziert sich die Sache, weil diese in der Regel auch entweder männlich oder weiblich sind. Nur ändert das nichts daran, dass das generische Maskulinum, zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen, eben nicht explizit Männer meint: Sowohl Frauen als auch Männer können Mediziner werden.
Regressive Geschlechtertrennung
Frauen sind dabei nicht nur «mitgemeint», sondern grundsätzlich inkludiert, da semantisch gar keine Geschlechtsspezifikation vorliegt (was auch das berühmte Gendersternchen, welches signalisieren soll, dass «diverse» Geschlechteridentitäten mitgemeint sind, überflüssig macht). Die weibliche Endung dient hingegen dazu, das Geschlecht der betreffenden Personen dort, wo es notwendig ist, zu spezifizieren. Das generische Maskulinum ist also die inklusivere Form, während das Gendern semantisch eine regressiv wirkende Geschlechtertrennung vornimmt.
Die Substantivierung von Partizipialformen übersieht den Bedeutungsunterschied zwischen Personen, die generell etwas tun, und solchen, die gerade etwas tun.
Besonders Begriffe, die auf «-er» enden, ziehen das derzeit vorherrschende Gender-Suffix «innen» förmlich an, obwohl die Endung «-er» an sich eine rein grammatikalische Funktion innehat, nämlich die eines substantivierenden Suffixes. Im Englischen wird so aus dem Verb «teach» das Substantiv «teacher», welches Lehrer jedweden Geschlechts bezeichnet. Während das Englische kein grammatikalisches Geschlecht kennt, ist diese Endung im Deutschen männlich, was aber eben nicht automatisch heisst, dass die gemeinten Personen ebenfalls männlichen Geschlechts sein müssen. Politisch korrekte Eindeutschungen wie «Influencerinnen» oder «Follower*innen» sind so gesehen doppelt unsinnig.
Auch bei Personengruppen, die aus lauter Männern und einer Frau bestehen, kommt es zu Ungereimtheiten, da sich die Endung «-innen» explizit auf weibliche Personen im Plural bezieht (eine Expertin und ein Experte sind keine Expertinnen). Dazu kommt, dass bei wirklich konsequentem Gendern bizarre Wortkonstruktionen entstehen. So müsste konsequenterweise von «Bundeskanzlerinnenkandidatinnen» die Rede sein. Es stimmt zwar, dass sich Sprache weiterentwickelt, aber in der Regel handelt es sich dabei um eine organische Entwicklung, die den Sprachgebrauch ökonomischer und nicht, wie bei diesem ideologischen und überkompensatorischen Eingriff, umständlicher macht.
Eine scheinbare Alternative bietet die Substantivierung von Partizipialformen. So wurden beispielsweise aus Studenten Studierende. Doch funktioniert dieser bemüht genderneutrale Ansatz auch nur bedingt, da er auf viele Begriffe nicht anwendbar ist (man kann aus Medizinern beim besten Willen keine Medizinenden machen). Ausserdem übersieht er den Bedeutungsunterschied zwischen Personen, die generell etwas tun oder können, und solchen, die gerade etwas tun. Nach einem Schiffsunglück ist es beispielsweise durchaus von Bedeutung, ob von Schwimmern oder von Schwimmenden die Rede ist. Aber auch aus Bäckern Backende zu machen, mutet skurril an.
Zudem gibt es im Deutschen eine ganze Reihe von Begriffen, deren Grammatik sich nicht mit dem Geschlecht der betreffenden Personen deckt, an denen sich aber offenbar niemand stösst. So ist «das Mädchen» per definitionem weiblich, steht aber im Neutrum. Und man sagt: «Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet.»
Blick über den Tellerrand
Aber genug der Grammatik. Bringt gendern überhaupt etwas? Die zugrunde liegende Hypothese, dass in Sachen Geschlechtergleichstellung sprachliche Veränderungen gesellschaftlichen kausal vorausgehen, dürfte den Karren vor das Pferd spannen. Obwohl es auf der Hand liegt, dass eine sprachkognitive Assoziation mit weiblichen Vertretern einer bestimmten Personengruppe eher stattfindet, wenn diese explizit erwähnt werden, bleibt es fraglich, ob die Abschaffung des generischen Maskulinums tatsächlich, wie oft suggeriert wird, zu einer Veränderung in der Berufswahl vor allem junger Mädchen und Frauen beitragen kann.
Hier lohnt sich wieder ein Blick über den deutschsprachigen Tellerrand. Denn hätte unser generisches Maskulinum wirklich die ihm zugeschriebenen gesellschaftlichen Auswirkungen, so müssten die entsprechenden Geschlechterunterschiede im sonst durchaus vergleichbaren englischen Sprachraum deutlich geringer ausfallen. Tun sie aber nicht: Das Geschlechterverhältnis in den verschiedenen Berufsgruppen ist keineswegs ausgewogener. Auch der vielzitierte «gender pay gap», der sich primär aus geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Berufswahl erklärt, ist etwa gleich gross. Das Gendern dreht also an den falschen Schrauben und ist somit kaum mehr als ein performativer Ausdruck vermeintlicher Progressivität.
Gerfried Ambrosch lebt als Literatur- und Kulturwissenschafter in Wien.
