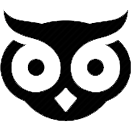Der hiesige Kampf gegen Rassismus sei aus den Fugen geraten, schreibt der Autor Kacem El Ghazzali. Mit der Realität der Betroffenen habe er schon lange nichts mehr zu tun.
NZZ, Kacem El Ghazzali, 07.11.2025,

Man stelle sich vor, eine beliebte Süssigkeit hiesse «Sklavenkopf». Die Empörung wäre gross. Doch genau so wird das Schaumgebäck, um dessen Namen bei uns gestritten wird, in arabischen Ländern genannt: Ras al-Abd – wörtlich: «Sklavenkopf». Wer auf Youtube auf Arabisch «Sklavenkopf» eingibt, findet Hunderte von Rezepten aus Marokko, Algerien, Tunesien und auch Syrien. Leider ohne Aufschrei – denn Abd (Sklave) ist bis heute eine gängige Bezeichnung für schwarze Menschen in vielen dieser Länder. Diese Realität wirft ein Schlaglicht auf eine bemerkenswerte Asymmetrie in der antirassistischen Debatte.
Die Zürcher Auseinandersetzung um historische Inschriften mit dem Wort «Mohr» an Altstadthäusern führte zu einem jahrelangen Rechtsstreit und gipfelte schliesslich in der Ankündigung, die Inschriften abzudecken. Der städtische Antirassismus-Beauftragte, Christof Meier, vermied in einem NZZ-Interview sogar, das Wort auszusprechen, und umschrieb es als «M-Wort» – in Analogie zum «N-Wort».
Will uns die Stadt Zürich damit sagen, dass «Mohr» so schlimm ist wie «Sklave»? Dass «Mohr» gleichzusetzen ist mit «Neger»? Diese implizite Gleichsetzung durch das Sprechverbot wirft grundlegende Fragen auf – nicht nur semantische, sondern auch historische und moralische.
Menschen werden zu Opfern gemacht
Ich verstehe diese Empörung nicht. Denn ich bin selbst, per Definition des Wortes, ein Mohr – ein Nachfahre jener nordafrikanischen Bevölkerung, die historisch so bezeichnet wurde. Und aus dieser Perspektive erscheint mir die Debatte in mehrfacher Hinsicht schief.
Der Mohr war in der Geschichte kein Opfer, sondern ein selbstbewusster Akteur. Zur Zeit der Griechen und Römer war Nordafrika integraler Teil der mediterranen Zivilisation. Die Grenze zum «anderen» verlief nicht am Mittelmeer, sondern in der Subsahara. Das antike Rom gab der Welt nordafrikanische Kaiser, Dichter und Denker.
Während des Christentums prägten maurische Gelehrte die Religion fundamental. Der heilige Augustinus von Hippo, einer der einflussreichsten Kirchenväter überhaupt, stammte aus dem heutigen Algerien.
Im Früh- bis Spätmittelalter war der Mohr ein Eroberer. Die maurische Herrschaft erstreckte sich über die Iberische Halbinsel und drängte bis nach Frankreich vor, wo sie erst 732 in der Schlacht von Tours gestoppt wurde. Maurische Heere erreichten sogar den Süden der heutigen Schweiz.
Nicht zwangsläufig verletzend
Die Umschreibung als «M-Wort» ist mehr als eine sprachliche Vorsichtsmassnahme; sie ist eine implizite Gleichsetzung. Sie legt nahe, dass «Mohr» in seiner Toxizität und Verletzungsmacht mit dem «N-Wort» oder eben dem Begriff «Sklave» vergleichbar sei. Diese Gleichsetzung ignoriert jedoch fundamentale Unterschiede.
«Mohr» ist historisch ambivalent. Der Begriff kann, wenn man es will, rassistisch konnotiert und verwendet werden. Er trägt diese Bedeutung aber nicht in sich. Er kann historisch-deskriptiv, neutral oder sogar als positive Selbstbezeichnung verwendet werden. Die Weigerung, «Mohr» auszusprechen, schafft damit erst jene eindeutige negative Bedeutung, die sie eigentlich nur zu reflektieren vorgibt.
Die Zürcher Debatte operiert mit der Prämisse, dass der Begriff «Mohr» für die Bezeichneten zwangsläufig verletzend sei. Diese Annahme ignoriert jedoch die Diskurse innerhalb vieler nordafrikanischer und diasporischer Communitys.
In Marokko feiert eine junge Generation von Nationalisten, was sie als «maurische/mohrische Kultur» bezeichnet. Sie besetzen den Begriff positiv und betonen ausschliesslich die Heldentaten der Vorfahren – oft in bewusster Abgrenzung und sogar abwertend gegenüber Arabern und anderen nicht nordafrikanischen Ethnien, inklusive schwarzer Afrikaner. Hier ist der Mohr wieder kein Opfer, sondern selbst Rassist und Täter.
Diese Perspektive findet in der eurozentrischen Zürcher Debatte kaum Beachtung. Es entsteht der Eindruck, dass ein postkolonial geprägter Diskurs ein Opfernarrativ über jene Gruppen legt, die sich selbst gar nicht primär als Opfer dieses Begriffs verstehen.
Massstäbe werden vermischt
Die Debatte wird von Ansätzen der Critical Race Theory und der Postcolonial Studies geprägt. Diese haben wichtige Perspektiven eröffnet, können aber auch eine selbstreferenzielle Dynamik entwickeln. Es ist ein professionelles Umfeld (aus Diversitätsberatern, Kommissionen usw.) entstanden, dessen Aufgabe die Identifikation von Diskriminierungsformen ist.
Dies führt zu einer problematischen Verschiebung: Je weniger eindeutiger Rassismus sichtbar ist, desto intensiver muss nach symbolischen oder ambivalenten Formen gesucht werden. Es besteht ein struktureller Anreiz – die Sicherung der eigenen Relevanz –, den Fokus permanent auf der Identifikation neuer Rassismen zu halten. Diese Notwendigkeit, fündig zu werden, verwischt die Massstäbe und erschwert die Differenzierung zwischen «Sklavenkopf», «Mohr» und «Neger».
Der professionelle Antirassismus stützt sich hier auf ein zentrales soziolinguistisches Argument: Die ursprüngliche Etymologie des «Mohren» sei irrelevant. Entscheidend sei, dass der Begriff im deutschen Sprachgebrauch eine rassistische Aufladung erfahren habe – als pauschalisierende Fremdbezeichnung, oft synonym mit «Neger» verwendet. Die Deutungshoheit, so das Argument, liege ausschliesslich bei den im hiesigen Kontext Betroffenen (zum Beispiel Afrodeutschen), und diese lehnten den Begriff ab.
Doch genau diese Argumentation, die vorgibt, kontextsensitiv zu sein, entlarvt ihre eigene Provinzialität. Sie isoliert den deutschen Sprachraum und macht ihn zum Nabel der postkolonialen Welt. Wäre dieser Ansatz konsequent, müsste er auch Begriffe wie «Araber», «Türke» oder den veralteten Begriff «Mohammedaner» problematisieren. Auch sie waren im kolonialen Diskurs oft pauschalisierend und rassistisch konnotiert, dennoch käme niemand auf die Idee, sie als «A-Wort» oder «T-Wort» zu umschreiben oder ihren Gebrauch zu verbieten.
Historischer Stolz
Die positive Selbstaneignung des «Mohren»-Begriffs in Nordafrika ist kein «reclaiming» nach westlichem Vorbild – also keine bewusste Wiederaneignung eines als rassistisch erkannten Begriffs analog zum «N-Wort». Im Gegenteil: Viele Marokkaner, die sich heute «Mauren/Mohren» nennen, tun dies aus purem historischem Stolz und wollen explizit so bezeichnet werden. Von der spezifisch deutschen Debatte, die den Begriff als rassistisch einstuft, haben sie oft nicht einmal Wind bekommen. Genau dieser Umstand offenbart die Provinzialität des Zürcher Diskurses, der annimmt, seine lokale Einstufung habe globale Gültigkeit.
Während Zürich über «Mohr» streitet, wird in Kairo «Sklavenkopf» serviert und in Libyen mit Menschen gehandelt. Diese Asymmetrie in der Wahrnehmung ist kein Zufall, sondern das Resultat eines Antirassismus, der paradoxerweise tief eurozentrisch ist. Er basiert oft auf der Annahme, Rassismus sei eine spezifisch westliche Pathologie, ein Produkt von Kolonialismus und Aufklärung. Diese Sichtweise ignoriert, dass Rassismus ein universelles Phänomen ist. Ibn Khaldun, einer der bedeutendsten nordafrikanischen Historiker des 14. Jahrhunderts, schrieb unverblümt: «Daher sind in der Regel die schwarzen Völker der Sklaverei unterwürfig, denn sie haben wenig Menschliches und haben Eigenschaften, die ganz ähnlich denen von stummen Tieren sind.» Die Gleichsetzung von «schwarz» und «Sklave» (Abd) im Arabischen ist jahrhundertealt, und der arabische Sklavenhandel war historisch von enormer Dimension.
Postkoloniale Ansätze tendieren dazu, diese Realitäten auszublenden. Die Sorge, als kulturell überheblich oder «orientalistisch» zu erscheinen, wenn man nichtwestlichen Rassismus kritisiert, führt zu einer selektiven Anwendung moralischer Standards. Man problematisiert «Mohr» mit grosser Inbrunst, weil es in die eigene (westliche) Schulderzählung passt, während man zu «Sklavenkopf» oder realer Sklaverei in anderen Regionen tendenziell schweigt. Man will Rassismus bei fremden Kulturen nicht kritisieren, um selbst nicht als Rassist bezeichnet zu werden – und sucht stattdessen mit dem Mikroskop in der eigenen Sprache nach Rassismus.
Kacem El Ghazzali ist ein marokkanisch-schweizerischer Islamwissenschafter und Publizist.