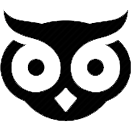Der Schriftsteller sieht sein Land nach den Wahlen in einer blamablen Verfassung. Die Eliten würden sich gegenseitig Pfründe zuschanzen – und mit Themen wie dem Gaza-Krieg Stimmung machen.
NZZ, Leon de Winter18.11.2025

Um die jüngsten Ereignisse in den Niederlanden zu verstehen, müssen wir von einem Thema zum nächsten springen. Das wird ein wildes Stück. Es geht um Politik, Kultur, Migration, Judenhass.
Wir beginnen mit Musik, genauer gesagt mit einem der Leuchttürme der europäischen Musikkultur: dem klassischen Konzertsaal Concertgebouw in Amsterdam.
Grosse Komponisten und Dirigenten haben das Concertgebouw-Orchester geleitet; die niederländischen Eliten erleben seit Generationen hochstehende Musikdarbietungen. Ausser über eine brillante Orchesterleitung verfügt das Concertgebouw über geschäftsführende Manager, die die Aufführungen organisieren und dafür sorgen, dass die Säle so gut wie möglich genutzt werden. Wie zum Beispiel für das jährlich stattfindende Chanukka-Konzert.
Jetzt wird es etwas komplizierter.
Was ist Chanukka? Chanukka ist ein altes jüdisches Fest. Die erste Feier kann genau datiert werden: auf das Jahr 164 v. Chr. Die Juden hatten gegen die Hellenisten rebelliert, die den Zweiten Tempel entweiht hatten, und nach dem Sieg ereignete sich in Jerusalem ein wahres Wunder: Ein kleines bisschen Öl, das normalerweise nur für einen Tag ausreichte, beleuchtete acht Tage lang die Menora, den Leuchter.
In einen Nebenraum verbannt
Chanukka wird also schon seit zweitausend Jahren gefeiert, und seit einigen Jahren im Concertgebouw mit einem Konzert vor einem Publikum aus Amsterdamer Juden und zionistischen Christen. Aber jetzt hat die Leitung des Concertgebouw das Chanukka-Konzert gestrichen. Der Grund dafür war der Kantor, also der liturgische Sänger. Er ist Israeli und singt auch für Einheiten der israelischen Armee IDF.
In einer Presseerklärung der Leitung heisst es: «Als Chief Cantor spielt Abramson [der Kantor] eine wichtige Rolle in den IDF und vertritt die IDF bei offiziellen Anlässen. Für das Concertgebouw ist entscheidend, dass die IDF aktiv an einem umstrittenen Krieg beteiligt sind und Abramson ein sichtbarer Vertreter davon ist.» Mit anderen Worten: Die Leitung des Concertgebouw ist überzeugt, dass die IDF eine Armee von Kriegsverbrechern ist, also ist auch der Kantor einer.
Inzwischen ist ein Kompromiss über dieses Chanukka-Konzert geschlossen worden: Die Juden dürfen in einem Nebenraum des grossen Concertgebouw eine geschlossene Vorstellung besuchen, die nun als religiöse Veranstaltung definiert wird und daher unter andere Regeln fällt. Viele Juden sind darüber entsetzt.
Israel wurde zum zentralen Thema bei den Wahlen
Warum hatten die Manager des Concertgebouw so viel Angst vor dem Kantor Abramson? Sie haben offensichtlich weder Zeit noch Interesse, sich mit dem komplexen Hintergrund des Nahostkonflikts auseinanderzusetzen, wie viele andere Bürger auch. Sie verlassen sich auf die Berichte in den Medien und sind überzeugt, dass die IDF in Gaza etwas angerichtet haben, was in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht.
Die Folgen davon beschränken sich nicht darauf, ob ein israelischer Sänger in Amsterdam willkommen ist. Israelische Touristen trauen sich nicht mehr, in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen oder eine Kippa zu tragen. Die Synagogen in Amsterdam werden streng bewacht. Unzählige kleine Angriffe gegen Juden werden stillschweigend hingenommen.
Doch was hat das mit der Politik zu tun und mit den vergangenen Wahlen?
Dazu muss man wissen: In den Niederlanden entspricht die Einstellung zu Israel und Gaza exakt der parteipolitischen Ausrichtung. Die Linke, der sich niederländische Muslime meist angeschlossen haben, steht hinter den Bewohnern Gazas, während die Rechte proisraelisch ist. Infolgedessen widmeten Politiker rund um die jüngsten Wahlen einen Grossteil der Diskussionen dem Thema Gaza.
Das Bizarre daran: Ein Konflikt, der sich mehrere tausend Kilometer entfernt abspielt und keine direkten niederländischen Interessen betrifft, wurde zu einem der grossen Streitpunkte im Vorfeld des Wahltags, angeheizt von linken Parteien und den Medien.
Profiteure des Politspiels
Die Wahlen vom 29. Oktober zeigten, dass die Einstellung der niederländischen Bevölkerung relativ stabil geblieben ist: Die Mehrheit ist weiterhin konservativ. Dass die Linke erneut geschrumpft ist, ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten zu beobachten ist: Alle linken Parteien haben zusammengerechnet kaum noch mehr Sitze als Geert Wilders’ populistische Partei für die Freiheit (PVV) allein, die 26 Sitze gewonnen hat. Auch die progressiv-liberale D66 – einst gegründet, um das niederländische politische System zu modernisieren – kommt auf 26 von 150 Sitzen.
Im Ausland ist man sich oft nicht bewusst, dass sich die Strukturen der Behörden in den Niederlanden seit 1848 in der Tiefe kein bisschen verändert haben. Nach den Wahlen bleiben die Spitzenbeamten unabhängig vom Resultat auf ihren Posten, das Geld fliesst weiterhin an dieselben NGO, die Netzwerke von Beratern und Lobbyisten bleiben so einflussreich wie zuvor. Was besonders aufstösst: Das sogenannte Jobkarussell, also der Kreislauf, in dem altgediente Politiker mit einem guten Regierungsjob belohnt werden, dreht sich munter weiter.
Seit 1848 werden in den Niederlanden wichtige Posten in der Gesellschaft durch Ernennungen besetzt. Bürgermeister werden nicht gewählt, sondern ernannt, ebenso die «Kommissare des Königs», also die Provinzgouverneure, sowie die Direktoren staatlicher Unternehmen wie der Niederländischen Eisenbahn. Wer einmal, egal ob links oder rechts, vom Establishment aufgenommen wurde, kann profitieren.
Vor zwei Jahren gewann Geert Wilders mit grossem Abstand die Wahlen. Er erhielt 37 Sitze. Nun fiel er auf 26 zurück – aber das ist für ihn immer noch das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere. Der Erfolg nützt ihm wenig: Wie vor 2023 wurde wieder ein Cordon sanitaire um ihn herum errichtet. Es muss eine Koalition gebildet werden, die anderen Parteien schliessen Wilders’ PVV von Anfang an bei den Verhandlungen aus.
Machtfaktor Postleitzahl-Lotterie
Rob Jetten, der junge Vorsitzende der Partei D66, hat eindeutig eine Vorliebe für die Linke, aber für eine Koalition mit ihnen fehlen ihm die Mehrheiten. Selbst für eine Mitte-links-Koalition braucht er in jedem Fall die VVD, die liberal-rechte Partei mit 22 Sitzen, die für jede Koalition unentbehrlich ist. Die VVD will jedoch ausschliesslich eine Mitte-rechts-Koalition. Aber ich frage mich: Spielt das überhaupt eine Rolle?
Rob Jetten war einige Zeit Klimaminister, was für einen so jungen Politiker bemerkenswert ist. Es wurde ein «Klimabudget» von 35 Milliarden Euro geschaffen, das, wie er auf eine Frage im Parlament antworten musste, zu einer Verringerung des Temperaturanstiegs auf der Erde führen wird – in der Tat: zu einer Verringerung des Anstiegs – um 0,000036 Grad Celsius. Jetten musste selbst darüber lachen. Aber er trat nicht zurück.
Die linksliberalen Eliten aus Politik, Medien und Kunst sowie Heerscharen von Studenten und Angehörigen der besseren Mittelschicht (das sind die Wähler von Rob Jettens D66) schwören auf die Idee, dass das Klima vom Menschen zerstört wird und auch wieder repariert werden kann. Sie glauben auch, dass die Welt von populistischen Faschisten wie Wilders und Trump bedroht wird und dass Israel genozidale Gewalt anwendet. Dieser Teil der Bevölkerung ist zwar in der Minderheit, aber in den Medien, den Behörden und der Kultur ausserordentlich stark vertreten.
Was die Situation in den Niederlanden noch komplizierter macht, ist die Rolle der – man wundere sich nicht – Postleitzahl-Lotterie. Ja, tatsächlich: Es gibt eine nationale Postleitzahl-Lotterie. Diese beherrscht den Lotteriemarkt. Die damit verbundenen Erträge fliessen in «gute Zwecke». Die Empfänger sind vor allem linke NGO, die sich mit dem Klima und Flüchtlingen befassen.
Die Lotteriemanager, NGO, linke Politiker, aktivistische Richter, die meisten Medien (einschliesslich der unabhängigen öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten) – sie bilden zusammen ein erstickendes Geflecht, das immer weiterbesteht, egal, wer die Wahlen gewinnt.
Alles ist nur noch Metapher
Die niederländische Demokratie hat sich von einer Elite einlullen lassen, die glaubt, das Recht zu haben, ihre Macht zu festigen, unabhängig davon, was die Bürger als ihre Interessen ansehen. Die Bürger wüssten nicht, was ihre Interessen seien, behaupten die Herrscher unseres Landes. Deshalb müssen sie durch die zwingenden Erkenntnisse insbesondere der D66 aufgeklärt werden, also der Partei, die – oh Ironie – 1966 gegründet wurde, um das Modell von 1848 zu modernisieren, aber seit Jahrzehnten den Status quo bewahrt.
Welcher Verwaltungsbeamte oder Politiker hat die Zeit, sich Gegenstimmen anzuhören? Und warum sollte er? Wer will schon mit der vorherrschenden Meinung brechen? Wer will schon ein verspotteter Dissident werden? Es ist sicherer, sich dem Tagesgeschehen anzuschliessen: Die Hamas sind Freiheitskämpfer, die Juden Israels sind Monster, der Klimawandel kann mit Verboten und Milliardenbeträgen von den Steuerzahlern bekämpft werden.
Ich bin mittlerweile zur ernüchternden Erkenntnis gelangt: Propaganda funktioniert. Die braven Direktoren des Concertgebouw sind Opfer davon. Auch die Wähler von D66 sind Opfer. Eine perfekte Marketingkampagne, besser gesagt: Propagandawelle, hat Rob Jetten, der doch von vielen als Operettenfigur angesehen wird, populär gemacht. Plötzlich begann er viel zu lachen, war fröhlich und übernahm Barack Obamas wunderbaren Slogan «Yes, we can». Jetten versprach viele schöne Dinge, insbesondere versprach er zur Lösung der Wohnungsnot den Bau von nicht weniger als zehn neuen Städten – aber das sollten wir, so sagte ein prominenter D66-Politiker unmittelbar nach dem Wahlsieg, als Metapher betrachten.
So geht das mit Politikern: Alles ist auf einmal Metapher. Niemand ist verantwortlich. Es sind nur Wörter.
Leon de Winter gehört zu den bekanntesten Schriftstellern der Niederlande. Zuletzt erschien von ihm der Roman «Stadt der Hunde» (Diogenes-Verlag).