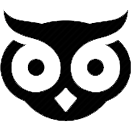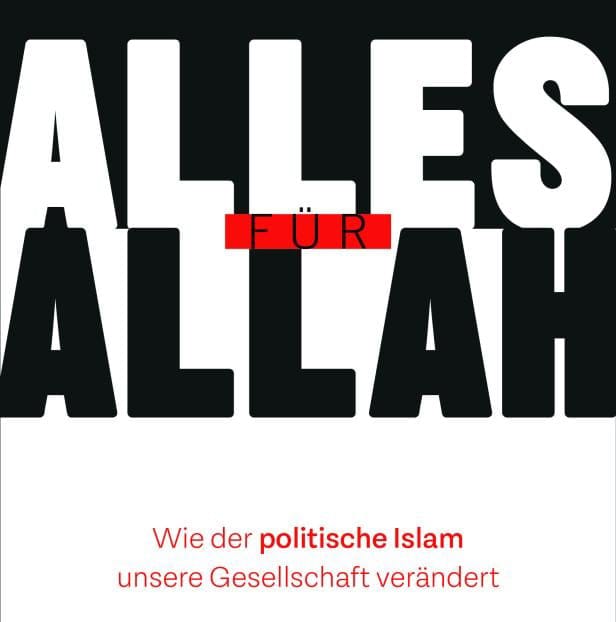
NZZ, Ahmad Mansour, 06.09.2025
Die Unterwanderung durch Islamisten ist kein apokalyptisches Zukunftsszenario aus einem Roman von Michel Houellebecq. Sie ist Realität. Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 ist das auch in Europa erkennbar – für alle, die bereit sind, der Gefahr ins Auge zu sehen.

Ein streng geheimer Bericht, der Ende Mai in Paris an die Öffentlichkeit gelangte, zeichnet ein beklemmendes Bild. Die Muslimbruderschaft, seit Jahrzehnten globaler Vorreiter des politischen Islam, verfolgt in Frankreich eine präzise ausgearbeitete Strategie: zunächst die Verankerung in Stadtteilen, wo Perspektivlosigkeit und soziale Not den Nährboden bereiten. Dann die Inszenierung als Kümmerer, der scheinbar Gemeinschaftsbedürfnisse stillt – Nachhilfe, Sozialarbeit, Freizeit. Als Nächstes folgt die schrittweise Durchsetzung religiöser Normen: Kopftuch, Geschlechtertrennung, Loyalität gegenüber der «Umma». Am Ende steht der Eintritt in die kommunale Politik, um Einfluss und Deutungshoheit zu sichern.
Unterschätzte Gefahr
Wer heute vor der Unterwanderung durch Islamisten warnt, wird gern als Panikmacher abgetan. Doch das ist ein fataler Fehler. Die Bedrohung wirkt unsichtbar – und genau darin liegt ihre Tücke.
Der Einfluss legal agierender islamistischer Gruppierungen ist längst Realität in den Metropolen Europas. Tag für Tag, Stück für Stück dringen Denkweisen des politischen Islam in die freien, demokratischen Gesellschaften ein – in Behörden, Parteien, Schulen, Vereine, Universitäten, Kliniken.
Muslime sind Individuen, nicht bloss Teile einer Gruppe. Als solche gehören sie angesprochen und einbezogen.
Der politische Islam sucht seine ersten Anknüpfungspunkte an den Rändern der Gesellschaft: in migrantischen Milieus, wo der Verlust von Identität gefürchtet wird, wo Eltern die Grundwerte der Aufklärung nicht als Chance, sondern als Bedrohung empfinden – und ihre Kinder davor «schützen» wollen. Besonders unter Geflüchteten, die entwurzelt, orientierungslos und misstrauisch sind, findet er ein Reservoir.
Gern gibt sich der politische Islam als Beschützer und Fürsprecher. Er inszeniert sich als kultureller Schild gegen Verwestlichung und zugleich als Ansprechpartner für eine Politik, die um Integration ringt. Doch in Wahrheit steht er für das Gegenteil: für Abkapselung, Desintegration, Parallelgesellschaft. Nur Menschen, die emotional nicht in Europa ankommen, sind empfänglich für seine Ideologie.
So spielt er ein doppeltes Spiel: nach innen mit der Pose der Fürsorglichkeit, nach aussen mit jener der Integrationswilligkeit. In Wirklichkeit aber erzeugt der politische Islam die Bruchlinien, von denen er lebt – und ohne die er keine Zukunft hätte.
Vereine als trojanisches Pferd
Geschickt gründen Islamisten Vereine, die sich für «Integration», «Dialog» oder «Vielfalt» einsetzen. Sie fischen nach Anhängern und Fördermitteln, nach Aufmerksamkeit in Medien, Politik und Wissenschaft. Sie bedienen sich der Sprache der Menschenrechte, des Völkerrechts und der Verfassung. Doch die Liebe zur Demokratie der «Ungläubigen» ist vorgetäuscht.
Die Strategie der Muslimbrüder ist der «lange Marsch durch die Institutionen» – eine Parole einst der Linken. Sie sind über muslimisch geprägte Staaten hinweg vernetzt, handeln diskret und lassen ihre Strukturen nur schemenhaft erkennen. Viele Mitglieder sind gebildet, haben hohen Status und Einfluss in Communitys und Netzwerken. Heute wirken sie weniger in Moscheen als in Kindergärten und Jugendzentren – sowie als Influencer in sozialen Netzwerken mit Millionen Followern.
Der politische Islam funktioniert längst über ein Cluster informeller Codes: mittels Sprechweisen, Haltungen, Loyalitäten. Begriffsbildungen wie «antimuslimischer Rassismus» oder «Islamophobie» dienen dazu, Kritik am Islamismus moralisch zu diskreditieren. Fixe Ideen von «Diversität» und «Religionsfreiheit» öffnen Lehrerinnen mit Kopftuch die Tür ins Klassenzimmer.
Überall in Europa mischen Vertreter des politischen Islam dort mit, wo es grosse muslimische Communitys gibt. Das ist keine Fiktion, sondern Praxis, Alltag, Realität – so funktioniert Unterwanderung.
Am weitesten ist die Islamisierung Europas in den Parallelgesellschaften Frankreichs, Belgiens und Grossbritanniens fortgeschritten. Noch hinkt Deutschland hinterher. Doch ohne klare Gegenstrategie drohen auch hier binnen eines Jahrzehnts «französische Verhältnisse».
Der politische Islam agiert auf zwei Ebenen: Einerseits infiltriert er linke Parteien, um deren Agenda für seine Ziele nutzbar zu machen. Andererseits bereitet er die Gründung eigener muslimischer Parteien vor – Formationen, die schon bald als politische Kraft auftreten könnten. Kritik an ihren Programmen oder an ihrem Personal wird reflexhaft als «fremdenfeindlich» oder «islamophob» abgewehrt – eine rhetorische Waffe, die nicht nur Muslime mobilisiert.
Die Folgen der Etablierung solcher Parteien wären gravierend: Zuerst träfe es die Politik gegenüber Israel und die jüdischen Gemeinden, denn Antisemitismus ist integraler Bestandteil der islamistischen Ideologie. Weiter wäre mit einem massiven politischen Backlash zu rechnen. Kurz- und mittelfristig wird Europa keine islamistische Regierung erleben – wohl aber ein massives Anwachsen des Rechtsradikalismus.
Eine gefährliche Polarisierung wäre die Folge. Europa stünde damit vor einer doppelten Bedrohung: dem politischen Islam und seinen Verbündeten von links auf der einen Seite – und dem erstarkenden rechten Fremdenhass als Reaktion darauf auf der anderen Seite.
Woher stammt der Islamismus?
Der politische Islam entstand nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende von Kalifat und Osmanischem Reich. Die Siegermächte schufen im Nahen Osten erste Nationalstaaten. Soziale und kulturelle Normen der islamisch geprägten Gesellschaften wichen denen des überlegenen Westens. Muslimische Eliten adaptierten Nationalismus und Sozialismus. Religiöse Milieus hingegen empfanden dies als Demütigung. In dieser Identitätskrise entstand 1928 in Ägypten die Muslimbruderschaft. Sie predigte eine totalitäre Rückkehr zur sunnitischen Orthodoxie: «Der Islam ist die Lösung.» Der Buchstabe des Koran sollte einzig und allein das Leben bestimmen.
Im Westen lebende Muslime waren für diese Dogmatiker zunächst nicht von Interesse. Doch 1984 veröffentlichte der ägyptische Theologe Muhammed al-Ghazzali sein Buch «Die Zukunft des Islam ausserhalb seiner Grenzen». Er warnte davor, dass Muslime im Westen durch Anpassung ihre Religion verlieren würden. Seine Remedur: Moscheen bauen, Halal-Supermärkte eröffnen, Ehen vermitteln, Kulturvereine gründen, Koranschulen etablieren. Europa solle durch eine kulturelle Gegeninvasion islamisiert werden.
In Unkenntnis dieser Kampfansage wurde die soziale Tätigkeit der Muslimbrüder in Europa lange begrüsst. Die Pflege ihrer Religion und ihrer Kultur sollte die muslimischen «Gastarbeiter» ruhigstellen, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren würden. Integration schien nicht notwendig, Parallelgesellschaften empfand man als normal.
Weil man dem Islam kirchenähnliche Strukturen geben wollte, brauchte man Repräsentanten. Aus dem Ausland entsandte konservative Islam-Funktionäre sprangen ein. Demokratische Parteien wiederum lechzten nach Wählerstimmen, schwiegen über Missstände und posierten lieber vor Moscheen. Damit lieferten sie dem politischen Islam Legitimation und Prestige. Islamistische Dogmatiker verachten die Demokratie – und dennoch werden sie bis heute als Dialogpartner hofiert. Kritik wird aus Angst vermieden. Ein Klima der Selbstzensur grenzt auch säkulare Muslime aus.
Die Frage der Demografie
Europa verharrt in Naivität: Radikale Islamisten fühlen sich hier inzwischen wohler als in vielen muslimischen Staaten, wo die Muslimbruderschaft verboten ist. Warum wird aggressives Islam-Gebaren an Schulen hingenommen? Warum wird zugelassen, dass säkulare Kinder Furcht vor islamistischen Peer-Groups haben? Warum verbergen jüdische Schüler ihre Religion? Das sind unhaltbare Zustände.
Was es braucht, ist echte Integrationsarbeit – um nicht jene Muslime zu verlieren, die längst das Gefühl haben, sich zwischen Islam und Demokratie entscheiden zu müssen. Obwohl Integration mittlerweile grossflächig scheitert, werden Probleme ignoriert. Für das soziale Klima zählt nicht nur, wer einwandert, sondern auch, wie viele es tun. Demografie aber wird dann zum Problem, wenn Demokratien die Muslime an die Radikalen verlieren.
Allen Migranten, die aus Diktaturen, Theokratien und Monarchien herkommen, muss klar sein: Leben in Europa bedeutet, Demokratie anzuerkennen. Das gilt für Männer, Frauen und Kinder. Wer dies verweigert, stösst auf Widerstand.
Der Einfluss dogmatischer islamischer Verbände muss massiv begrenzt werden. Es darf keine Toleranz für islamistische Kindergärten oder für Kopftuchzwang bei kleinen Mädchen geben. Keine Sonderrechte beim Schwimmunterricht, keine Ausnahmen bei Exkursionen. Schulen haben die Aufgabe, Kinder zu mündigen Bürgern zu erziehen. Muslimische Eltern müssen lernen, dass ihre Kleinen Grundrechte haben – und nicht ihr Eigentum sind.
Generell gilt es, mehr Säkularismus zu wagen. Proaktiv, klar, furchtlos. Muslime sind Individuen, nicht bloss Teile einer Gruppe. Als solche müssen sie angesprochen, einbezogen und gestärkt werden.
Europa braucht Staaten, die Vereine und Verbände, mit denen sie kooperieren, nach demokratischen Massstäben auswählen. Staaten, die ihnen feindlich gesinnte Gegner identifizieren, sie benennen und robust behandeln. Nur durch ein konsequentes Durchsetzen der zivilisatorischen Normen und Werte des Westens lässt sich die Spirale der islamischen Radikalisierung durchbrechen, deren Zeuge wir derzeit werden.
Ahmad Mansour ist ein deutscher Psychologe, Israeli arabischer Herkunft und Muslim aus einer palästinensischen Familie. Er setzt sich seit Jahren für Integration, Aufklärung und den Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus ein.