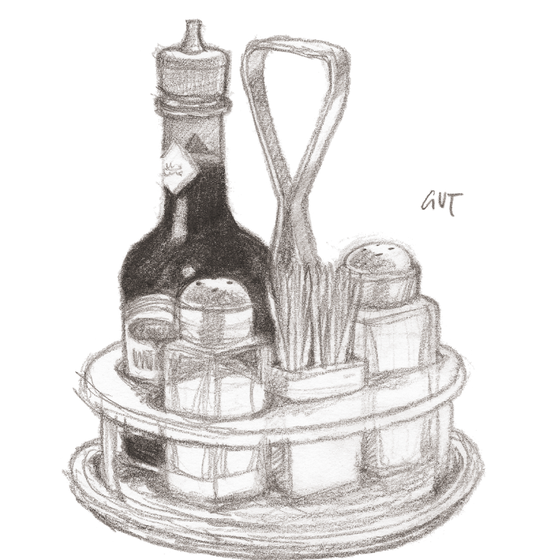
Das Milizsystem basiert auf der Einsicht, dass es den perfekten Staat in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht geben kann
Republik kommt von Res publica. Die Miliz-Schweiz nimmt die Republik sozusagen beim Wort. Indem es die Bürger in die Pflicht nimmt, erzeugt das Land unablässig Öffentlichkeit und damit sich selbst: tagaus und tagein, kurz und langfristig, in Gümligen oder Zofingen genauso wie in der einen und keineswegs unteilbaren Nation.
NZZ, Oliver Zimmer 8.7.2019
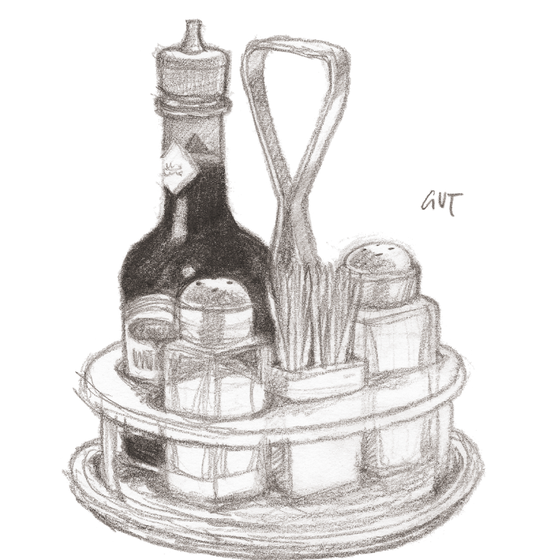
Illustration: Peter Gut
Das Besondere am Milizsystem ist die enge Verzahnung von Zivilgesellschaft und Staat. In Ländern, in denen die Macht bei den Berufspolitikern liegt, sind die Linien diesbezüglich klarer gezogen. Man könnte auch sagen: Der Staat hat dort die Zivilgesellschaft, inklusive der Medien, besser im Griff. Die Politiker können sich dort leichter in eine Blase von gleichgesinnten Kollegen und Experten zurückziehen. Auch in der Miliz-Schweiz bilden sich ständig solche Politblasen; bloss platzen sie dort schneller als etwa in Deutschland oder Frankreich.
Auf den Punkt gebracht: Im Milizsystem machen die Bürger den Staat – im Dialog mit den Berufspolitikern und Experten aus Wissenschaft und Verwaltung. Dadurch wird das Leben in einem hohen Masse politisiert. Nicht im Sinne von Parteipolitik; eher im Sinne der Erhebung der Zivilgesellschaft zu einem politischen Machtfaktor. Das ist – in dem Masse, wie es in der Schweiz geschieht – ungewöhnlich. Manche würden vielleicht gar sagen: Das ist unzeitgemäss.
Vorteile liegen auf der Hand
Dabei liegen die Vorteile des Milizsystems auf der Hand. Gemäss dem Politologen Markus Freitag fördert es die Entstehung von sozialen Netzwerken und damit das soziale Vertrauen. Vertrauen wirkt kooperationsfördernd und senkt die Koordinations- und Transaktionskosten. Von dieser sozialen Nachhaltigkeit profitiert auch die Volkswirtschaft, und zwar nicht zu knapp. Laut dem Ökonomen Bruno S. Frey befinden sich «Demokratien mit einer direkten Mitwirkung bei politischen Entscheidungen» gegenüber «rein repräsentativen Demokratien» wirtschaftlich im Vorteil. Die stärker direktdemokratisch verfassten Kantone der Schweiz weisen im Durchschnitt ein «höheres Pro-Kopf-Einkommen» aus als Kantone «mit geringeren Beteiligungsmöglichkeiten des Volkes».
Nicht nur sind Staatsquote und Bürokratie in der Milizdemokratie etwas niedriger als in rein repräsentativen Systemen. Ihre Bürger sind zufriedener. Sie sind zufriedener als jene, die alle vier oder fünf Jahre ein neues Parlament und eine neue Regierung wählen, um sich danach wieder in den Passivdienst abmelden zu dürfen. Zufriedener sind sie deshalb, weil sie einander mehr vertrauen.
Und gleichzeitig steht das Milizsystem seit einiger Zeit stark unter Druck. Professionalisierung und Individualisierung der Gesellschaft; Zentralisierung des Staates; Ausdehnung des Staatssektors in die Privatwirtschaft – all diese Vorgänge setzen dem Milizsystem zu. Gemeinden haben heute oft Mühe, qualifizierte Interessenten für Exekutiv- und Kommissionsämter zu gewinnen. Mancherorts müssen sich die Gemeinderäte aus Mangel an Konkurrenz keiner Wahl stellen. Und was das Bundesparlament anbelangt: Dieses ist heute faktisch weitgehend ein Berufsparlament.
Auch ein drohender Abbau demokratischer Mitbestimmung gehört in diesen Problembereich. Ein solcher würde das Milizsystem schon deshalb schwächen, weil die direkte Demokratie sich positiv auf das freiwillige Engagement der Schweizer in Vereinen auswirkt. Markus Freitag bezeichnet die direkte Demokratie deshalb als «eine zentrale Stellschraube zur Förderung» der Zivilgesellschaft in der Schweiz. Zivilgesellschaft und soziales Vertrauen gehören zusammen. Sie wachsen und sie sterben zusammen. So besehen, wirkt der Umstand, dass einige Wirtschaftsvertreter das direktdemokratische Mitspracherecht als Unsicherheitsfaktor in den Verhandlungen mit der EU betrachten, noch etwas befremdlicher.
Skeptische Grundhaltung
Trotzdem stellt sich aufgrund der beschriebenen Krisensymptome natürlich die Frage, ob das Milizsystem seinen Zenit überschritten habe. Ein solcher Schluss wäre voreilig. Mehr noch: Er wäre staatspolitisch bedenklich. Ein Land, das seine Bürger über die aktive Teilnahme am Staatsaufbau in den Zustand der Mündigkeit versetzt, hat auch im Zeitalter der Globalisierung viele Stärken aufzuweisen. Eine erste besteht in einer systemskeptischen Grundhaltung. Das Milizsystem basiert auf der Einsicht, dass es den perfekten Staat nicht gibt: dass es diesen in einer freiheitlichen Gesellschaft niemals geben kann. Und weil das so ist, machen wir, unvollkommen wie wir nun einmal sind, es halt selber – mit einem Maximum an Beteiligung und Selbstverantwortung; im Vertrauen auf die eigene und die Erfahrung anderer.
Dennoch ist das natürlich kein perfektes System, das Milizsystem. Aber eines, das trotz seinen Mängeln hochmodern ist. Modern ist es auch deshalb, weil es den Staat nicht als Fremdkörper, sondern als bürgerlich-demokratisches Unternehmen begreift. Nicht als ein Heiligtum, für das man beten sollte; aber auch nicht als Schuft, den man bei jeder sich bietenden Gelegenheit verteufeln darf. Bei der Frage, ob wir uns das Milizsystem in unserer globalen Welt noch leisten können, kommt mir Winston Churchills Kommentar zur Demokratie in den Sinn: «Democracy is the worst form of government – except for all the others that have been tried from time to time.»
Das Milizsystem basiert auf der Einsicht, dass es den perfekten Staat nicht gibt: dass es diesen in einer freiheitlichen Gesellschaft niemals geben kann.
Eine zweite Stärke des Milizsystems besteht in der Betonung des Ortsprinzips. Damit meine ich einerseits die Einsicht, dass menschliche Gesellschaften mehr mit Orten zu tun haben als mit geometrischen Räumen. Die meisten von uns verbringen ihr Leben – wenn sie ehrlich sind – ja nicht im Weltraum, sondern an bestimmten Orten: vom Weiler zur Gemeinde, vom Redaktionskollektiv in Downtown Switzerland zum universitären Seminarraum, vom Frauenverein Bern zum Quartierverein Zürich Hottingen, von der Region zur Nation.
Mit dem Ortsprinzip meine ich aber noch etwas anderes. Hier geht es um das Wissen und die Erfahrung von Menschen. Die Bürger eines Landes befinden sich in unterschiedlichen Lebenslagen, üben diverse Rollen und Berufe aus, haben verschiedene Identitäten. Im funktionierenden Milizstaat werden diese Unterschiede zu den Aktiven geschlagen. Man behandelt sie nicht nur als statistisch signifikante Daten, sondern als Wissensbestände.
Eine dritte Stärke des Milizsystems besteht darin, «Echo-Chambers» aufzubrechen. Viele von uns sind heute Mitglied solcher Echokammern. Und seien wir ehrlich: Sind wir nicht alle furchtbar glücklich, wenn wir Menschen begegnen, die unsere Meinungen weitgehend teilen; besonders dann, wenn sie uns auf wunderbare Weise erklären, weshalb wir immer schon recht hatten?
Staatspolitisch gesehen sind solche Echokammern jedoch ein grosses Problem; eines, das sich durch das Internet zusätzlich verschärft hat. Wer ein paar Minuten in den Twitter-Kontos von gewöhnlichen Parlamentariern stöbert, erkennt das dominante Muster: Man lobt und verschickt jene Beiträge, die der eigenen Meinung entsprechen. Die andern ignoriert man oder macht sich (im günstigen Fall) über sie lustig.
Das Milizsystem hält für seine Bürger eine ständige Botschaft bereit. Sie lautet: Diese Art von Republik gibt es genau so lange, wie ihr euch dazu bekennt.
Offenbar haben sich mit dem Internet auch die medialen Echokammern eher verfestigt. Manche Redaktionen kultivieren bei Schlüsselthemen einen Tunnelblick. Einige halten sich auf Anordnung von oben einen Kolumnisten mit abweichender Meinung, denn zu viel Einheitsbrei steht im Widerspruch zur rhetorisch gelebten Weltoffenheit. Auch die Alibikolumnisten sind ein Phänomen unserer Echokammerepoche.
Eine vierte Stärke des Milizsystems hängt eng mit der Systemskepsis zusammen, über die eingangs diskutiert wurde. Es geht um den Glauben an die Alternativlosigkeit gesellschaftlichen Wandels. Wer in einem Milizsystem sozialisiert wurde, wird diesen Glauben hinterfragen. Das Denken in Kategorien der Alternativlosigkeit ist keineswegs neu. Wir finden es im zirkulären Weltbild des Altertums. Wir begegnen diesem Denken aber vor allem in den modernen politischen Ideologien. Es hat die liberale wie die sozialistische Bewegung gleichermassen geprägt. Im Kern handelt es sich um Heilsversprechen im säkularen Gewand.
Die liberale Version dieses säkularen Messianismus findet sich in Francis Fukuyamas Buch «Das Ende der Geschichte». In seinen Versatzstücken begegnen wir ihm auch in vielen renommierten Zeitungen. Die Grundannahme ist fast immer dieselbe: Der Fortschrittszug fährt in eine bestimmte Richtung; man muss auf den Zug aufspringen; dazu gibt es keine Alternative. Politiker, die in Kategorien der Alternativlosigkeit denken und handeln, schreiben sich eine ungeheure Machtfülle zu. Die Konstruktion von Alternativlosigkeit dient ihnen als ideologische Waffe. Wer in Kategorien von Alternativlosigkeit denkt, kann mit Demokratie nicht viel anfangen.
Stachel im Fleisch der Gerechten
Wie bringt man die Schweizer dazu, die Krise des Milizsystems ernst zu nehmen? Vielleicht müsste man vermehrt betonen, dass die Schweiz ein Stachel im Fleisch der Gerechten ist. Ein Widerspruch gegen eine sich zunehmend verflachende und entpolitisierende Welt. In einer Zeit, in der Regierungen und Spitzenbeamte den Segen im institutionellen Transnationalismus suchen, tritt der Nonkonformismus made in Switzerland wieder stärker hervor.
Schuld an diesem Nonkonformismus tragen selbstverständlich nicht die braven Schweizer. Am allerwenigsten ihre umtriebigen Professoren, Schriftsteller, Chefredaktoren und Wirtschaftsführer. Mögen die auch mit jedem Tag etwas mehr zur Stromlinienform tendieren: Das Land wird dadurch, zumindest vorerst, nicht aerodynamischer. Das Milizsystem hält für seine Bürger eine ständige Botschaft bereit. Sie lautet: Diese Art von Republik gibt es genau so lange, wie ihr euch dazu bekennt. Sollte sich dieses Bekenntnis vor lauter Sehnsucht nach politischer Aerodynamik in Luft auflösen, dann ist es mit dem Bürgerstaat vorbei.
Oliver Zimmer ist Professor für moderne europäische Geschichte an der University of Oxford. Zu seinen thematischen Schwerpunkten gehören der europäische Nationalismus sowie die Geschichte der Religion und des Liberalismus. Der Text basiert auf einer Rede des Autors am «Tag der Versicherer» des Schweizerischen Versicherungsverbandes vom 21. 6. 19.
