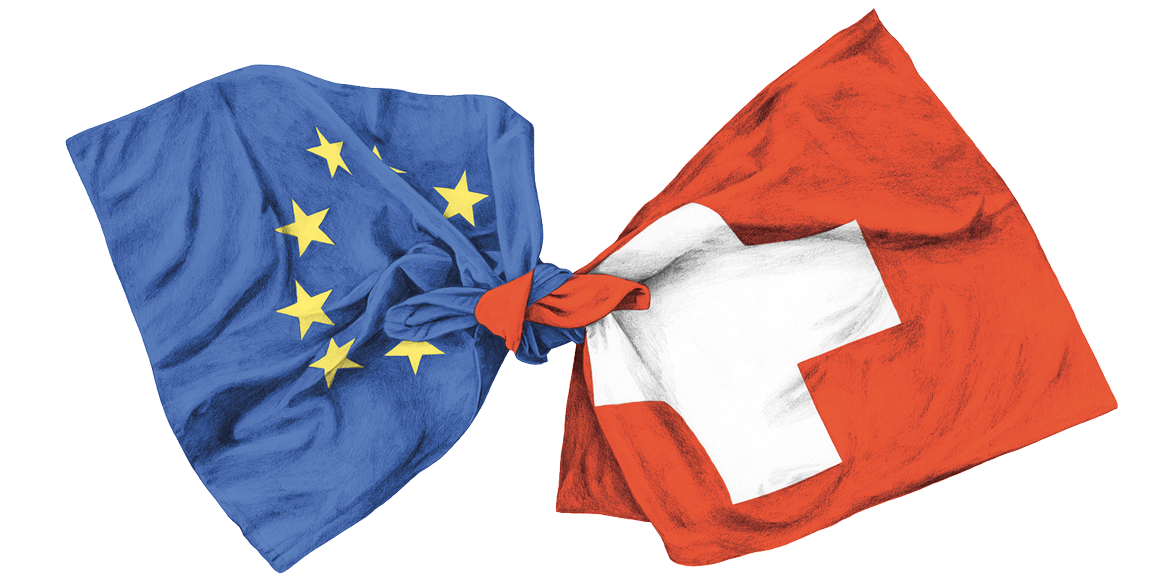
Staatsrechtler Andreas Glaser: «In der Schweiz ist man sich über die Tragweite des EU-Abkommens nicht im Klaren»
Mit dem EU-Vertrag würde das Schweizer Parlament spürbar an Bedeutung verlieren, sagt der Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser. Die Schweiz müsste lernen, mit der EU politische Deals abzuschliessen. «Viktor Orban macht vor, was alles möglich ist.»
Nach dem Abschluss der «Bilateralen III» würden Initiativen und Referenden nach Meinung des Staatsrechtlers Andreas Glaser nicht zur reinen Folklore.
NZZ, Katharina Fontana, 23.01.2024

Herr Glaser, die Befürworter sagen, dass man mit den «Bilateralen III» bloss den bisherigen Weg weiterführe, für die Gegner würde die Schweiz mit dem «Kolonialvertrag» ihre Selbständigkeit aufgeben. Wie bedeutend ist das geplante EU-Abkommen für die Staatsordnung der Schweiz?
Meiner Ansicht nach sehr bedeutend. Das Abkommen würde die dynamische Rechtsübernahme über alle bilateralen Verträge bringen, zudem würde der Europäische Gerichtshof (EuGH) neu eine wichtige Rolle spielen. Diese beiden Elemente im Abkommen würden das Verhältnis der Schweiz zur EU auf eine ganz andere Stufe heben.
Die dynamische Rechtsübernahme und der EuGH waren bereits im gescheiterten Rahmenabkommen vorgesehen. Was hat sich im Vergleich dazu geändert?
Die Rolle des EuGH soll enger und präziser definiert werden. Auch sind die Risiken, die sich aus einem übergeordneten institutionellen Rahmenabkommen hätten ergeben können, nun kleiner, da die Regeln in jedem einzelnen bilateralen Vertrag festgehalten sind und auch nur für diesen betreffenden Vertrag gelten. Beim Rahmenabkommen war beispielsweise ungewiss, ob das Freihandelsabkommen auch darunterfallen würde, jetzt ist das klar ausgeschlossen. Das neue EU-Abkommen ist berechenbarer als das Rahmenabkommen. Aber es geht weit über das hinaus, was heute gilt. Mir scheint, dass man sich über die institutionelle Tragweite des Abkommens nicht überall im Klaren ist.
Wo sehen Sie die grösste Änderung für das Schweizer System?
Beim Parlament. Viele Änderungen des EU-Rechts werden von der Schweiz heute ja nicht übernommen, beispielsweise bei der Personenfreizügigkeit. Würde sich die Schweiz zur dynamischen Rechtsübernahme verpflichten, bliebe dem Parlament keine andere Wahl, als Änderungen des EU-Rechts zu übernehmen und innerstaatlich umzusetzen. Wir kennen das vom Schengen-Abkommen, wo die dynamische Rechtsübernahme bereits gilt. Bei der Frontex-Vorlage oder bei der Waffenrichtlinie konnte man sehen, wie das läuft, und so wäre es dann auch bei allen anderen bilateralen Verträgen. Das Parlament würde spürbar an Bedeutung verlieren.
Die Schweiz übernimmt schon heute viel EU-Recht freiwillig. Wie gross wäre der Unterschied zwischen dem autonomen Nachvollzug und der dynamischen Rechtsübernahme?
Beim autonomen Nachvollzug kann die Politik Lobbygruppen einbeziehen, Vernehmlassungen durchführen, unterschiedliche Interessen berücksichtigen, schauen, was für die Schweiz politisch opportun ist und so weiter. Das würde mit der dynamischen Rechtsübernahme schwieriger. Das Parlament müsste ausloten, ob es rechtliche Spielräume gibt, und falls ja, wie man diese ausnutzen könnte, für einen Swiss Finish beispielsweise. Es müsste sich unbedingt eine Strategie überlegen, wie es mit der dynamischen Rechtsübernahme umgehen möchte, das wäre ja ein laufender Prozess. Im Strombereich beispielsweise ist mit ständigen Änderungen des EU-Rechts zu rechnen, die das Parlament übernehmen müsste.
Gibt es überhaupt Spielraum bei der Umsetzung von EU-Richtlinien?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Richtlinien, die rechtliche Spielräume offenlassen, und andere, die das nicht tun – etwa beim Strommarkt. Bei der Liberalisierung des Strommarkts müsste die Schweiz mitmachen, da gäbe es keinen Handlungsspielraum.
Die Gegner des EU-Abkommens sagen, die Volksrechte – Initiative und Referendum – würden damit zur Folklore.
Initiative und Referendum hätten weiterhin einen wichtigen rechtlichen und politischen Einfluss. Sie würden nur dann zur Folklore, wenn man jede Initiative und jedes Referendum, das zu Friktionen mit den Bilateralen führen könnte, ungültig erklären würde.
Wäre es noch möglich, mit einer Initiative eine Begrenzung der Zuwanderung zu verlangen, wie es die SVP mit ihrer «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative vorsieht?
Das Parlament setzt Volksinitiativen schon heute nicht um, wenn die Schweiz damit gegen die Bilateralen verstossen würde. Das hat man bei der Alpeninitiative gesehen und bei der Masseneinwanderungsinitiative: Beide Initiativen wurden faktisch nicht umgesetzt. Bei einem neuen Volksbegehren, das gegen die Bilateralen verstösst, wäre es dasselbe. Das EU-Abkommen würde den Vorrang des bilateralen Rechts einfach noch auf weitere Bereiche ausdehnen.
Dann kann man sagen, dass die Bilateralen schon heute eine materielle Schranke für Volksinitiativen sind. Das Volk kann zwar über eine EU-rechtswidrige Initiative abstimmen, doch umgesetzt wird das Anliegen anschliessend nicht.
So apodiktisch würde ich es nicht ausdrücken. Die Initiative behält ihre Funktion als Ventil und als Instrument, Themen auf die politische Agenda zu bringen. Bei der Ausschaffungsinitiative etwa ist es gelungen, eine Regelung auszuarbeiten, die von der EU toleriert wird, obschon die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU sie nicht zulassen würde. Generell gilt: Die Volksrechte bewegen sich nicht im luftleeren Raum, die politische Umsetzbarkeit spielt eine wichtige Rolle, ebenso die Signalwirkung, die ein Volksentscheid gegenüber dem Ausland hat. Bei der Schwarzenbach-Initiative 1970 beispielsweise musste die Schweiz die Personenfreizügigkeit noch nicht einhalten, aber die politischen Verwerfungen gegenüber Italien und anderen Nachbarstaaten wären bei einer Annahme enorm gewesen.
Das EU-Abkommen wird das Aufenthaltsrecht für Ausländer ausweiten, was dem Verfassungsartikel über die Masseneinwanderung entgegenläuft. Wenn die Schweiz das EU-Abkommen abschliessen will, müsste sie dann nicht ehrlicherweise die Bundesverfassung so anpassen, dass diese Widersprüche zum EU-Recht wegfallen?
Im Prinzip ja. Das Parlament müsste beim Abschluss des EU-Abkommens eine Bereinigung vornehmen und den Stimmberechtigten jene Artikel, die dem Abkommen widersprechen, zur Aufhebung oder Anpassung vorlegen. Das wird es aber natürlich nicht machen, um nicht noch mehr Angriffsfläche gegen das Abkommen zu bieten.
Wie sieht es mit dem Referendumsrecht aus? Inwieweit könnte das Volk die Übernahme von neuem EU-Recht verweigern?
Das Referendum bliebe vorbehalten, das Volk könnte Nein sagen. Ein völlig freier Entscheid wäre aber kaum möglich, denn bei einem Nein würden Sanktionen drohen – welche, das wüsste man im Vorneherein nicht. Damit würde sich natürlich der Abstimmungskampf ändern, der Druck auf die Stimmberechtigten dürfte zunehmen, und das Hauptargument wäre, dass sich die Schweiz bei einem Nein auf Probleme mit der EU einstellen muss. Diese Schwierigkeit stellt sich aber nicht nur beim EU-Recht. Auch bei der OECD-Steuerreform wurde argumentiert, dass die Stimmbevölkerung unbedingt zustimmen müsse und es keine Alternative gebe. Sobald man sich in einem internationalen Kontext bewegt, gibt es solche Situationen. Damit wird die Schweiz leben müssen.
Machen wir irgendein Beispiel: Die EU führt in einer Richtlinie schärfere Regeln zum Zucker ein, die Schweizer finden das bevormundend und lehnen das Zuckergesetz an der Urne ab. Wie geht es dann weiter?
Die Sache gelangt zuerst in den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU. Dort wird man versuchen, eine politische Einigung zu erreichen. Gelingt das nicht, kann die EU-Kommission das Schiedsgericht anrufen. Das Schiedsgericht wird den Fall dem EuGH unterbreiten, da es sich bei der Richtlinie um EU-Recht handelt, und wird anschliessend gestützt auf dessen Antwort den Fall entscheiden. Es könnte die Schweiz beispielsweise dazu verurteilen, Strafzahlungen zu leisten, solange die Richtlinie nicht umgesetzt wird.
Welche Rolle käme dem Bundesgericht gemäss EU-Abkommen zu?
Das Bundesgericht würde einen konkreten Streitfall – etwa zur Spesenregelung – als oberstes nationales Gericht beurteilen. Für die beteiligten Parteien wäre mit einem solchen Urteil Schluss, ein Weiterzug wäre nicht möglich. Aber es könnte sein, dass die EU-Kommission mit dem Urteil nicht zufrieden ist und die Meinung vertritt, das Bundesgericht habe eine Praxis etabliert, die gegen das Binnenmarktrecht verstosse. Heute kann man solche Fälle nur im Gemischten Ausschuss diskutieren. Neu wäre es möglich, dass die EU-Kommission diese Fälle, für die man im Gemischten Ausschuss keine Lösung findet, vor das Schiedsgericht bringt.
Das seinerseits den EuGH einbeziehen würde.
Das wird häufig der Fall sein, ja. Das Schiedsgericht wird die Streitfrage dem EuGH vorlegen, und dieser wird dann vielleicht sagen: «Ist doch klar, es gelten die Spesen von Bulgarien oder Polen und nicht jene der Schweiz. Die Praxis des Bundesgerichts ist nicht haltbar.»
Auch das Bundesgericht würde also an Bedeutung verlieren.
Es könnte Streitfälle, bei denen es um die Bilateralen geht, nicht mehr abschliessend beurteilen. Bisher konnte es das. Im Bereich der Ausschaffungen von kriminellen EU-Bürgern hat es selbständig eine Praxis entwickelt und gesagt, diese sei mit der Personenfreizügigkeit vereinbar. Der EuGH würde dies nie im Leben so sehen, wenn man ihn fragen würde.
Die Ausschaffungen sind ein Bereich, der laut dem geplanten EU-Abkommen von der Überprüfung durch den EuGH ausgenommen sein soll.
Das ist so. Aber es wird andere Fälle geben, in denen Juristen aus der EU zu dem Schluss kommen werden, dass die Praxis des Bundesgerichts EU-rechtswidrig sei. Und diese Fälle könnten eskalieren. Aber: Die EU-Kommission müsste aktiv werden und das Schiedsgericht anrufen. Sie wird das nur tun, wenn sie es als politisch opportun ansieht.
Dann wird es also auch darauf ankommen, wer in der EU-Kommission sitzt und ob diese Person der Schweiz wohlgesinnt ist?
Das dürfte eine massgebliche Rolle spielen. Salopp gesagt könnte es sein, dass letztlich die Freigabe von Munitionslieferungen an die Ukraine ein Schiedsverfahren gegen die Schweiz verhindern würde – Viktor Orban macht vor, was alles möglich ist. Ob die Schweiz in der Lage sein wird, solche politischen Deals zu machen, weiss man nicht. Entscheidend wird sein, wo die Interessen der EU-Kommission liegen und ob sie einen Nutzen darin erkennt, sich wegen der Schweiz zu verausgaben.
Das Ganze tönt ziemlich nach politischer Willkür und nicht nach der Rechtssicherheit, mit der die Befürworter des Abkommens argumentieren.
Das Schiedsgericht wird irgendwann eine konsistente Praxis entwickelt haben, und dann trägt dies zur Rechtssicherheit bei. Doch es ist so: Der Hebel liegt bei den politischen Institutionen. Die EU-Kommission muss Prioritäten setzen, die Schweiz dürfte für sie nicht im Fokus stehen.
Die Konferenz der Kantonsregierungen scheint Feuer und Flamme zu sein für das neue Abkommen. Was würde sich für die Kantone ändern?
Möglicherweise sind sich die Kantone nicht bewusst, welche Folgen das Abkommen für sie selber haben würde. Ihr politischer Einfluss – über Vernehmlassungen, über den Ständerat, aber auch informell – würde kleiner. Zudem könnten auch Streitfälle, welche die Kantone verursachen, vor dem Schiedsgericht landen.
Können Sie ein Beispiel geben?
Die kantonalen Arbeitsinspektorate müssen die Einhaltung des Arbeitsgesetzes kontrollieren. Es ist vorstellbar, dass die Kantone neue EU-Regeln unterschiedlich interpretieren und vollziehen. Wer zahlt die Strafe, wenn ein Kanton einen Streitfall auslöst, der vor dem Schiedsgericht endet? Die Kantone müssen sich bewusst sein, dass sie stärker in die Haftung genommen werden können.
Braucht es für das Abkommen ein obligatorisches Referendum mit Ständemehr?
Angesichts der Präzedenzfälle, die es gibt – den EWR und das Freihandelsabkommen –, muss die Bundesversammlung das Abkommen dem obligatorischen Referendum unterstellen. Sonst würde sie einen Bruch gegenüber ihrer bisherigen, mehrfach bestätigten Praxis vollziehen, die besagt: Greift ein Abkommen tiefgreifend in die verfassungsrechtliche Ordnung ein oder sprechen bedeutende sachliche oder politische Gründe dafür, dann braucht es das obligatorische Referendum. Doch das Parlament kann sich anders entscheiden, daran hindern kann man es nicht.
Was halten Sie vom Argument, dass man auch die Abkommen zu Schengen/Dublin mit ihrer Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme nur dem fakultativen Referendum unterstellt habe und man es deshalb beim EU-Abkommen ebenso machen könne?
Das dünkt mich sehr formalistisch. Das neue Abkommen sieht die dynamische Rechtsübernahme in sämtlichen bisherigen und künftigen bilateralen Verträgen vor und führt zudem das neue Schiedsgerichtsverfahren ein. Es hat damit eine deutlich andere Qualität als die Schengen-Dublin-Abkommen. Es wäre vom Parlament auch weitsichtiger, den Vertrag dem obligatorischen Referendum zu unterstellen und ihn damit zusätzlich zu legitimieren, anstatt den Weg des geringeren Widerstands zu gehen.
Andreas Glaser ist seit 2013 Professor an der Universität Zürich für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht unter besonderer Berücksichtigung von Demokratiefragen. Daneben ist er Direktionsmitglied am Zentrum für direkte Demokratie in Aarau. Glaser hat an der Universität Heidelberg habilitiert.
